Talk about
29.04.2024 |
Krafttraining: Wie lässt sich seine Effektivität messen?
Woher wissen Sie, welche Übungen für den aktuellen Leistungszustand Ihrer Mitglieder verantwortlich sind? Yassin Jebrini erklärt, warum selbst eine regelmäßig durchgeführte Leistungsdiagnostik zwischen bestimmten Krafttrainingsblöcken nicht ausreicht und wie solche Testbatterien beim Krafttraining um Neuro-Self-Assessments ergänzt werden können.
 ©Jebrini-Training
©Jebrini-Training
Lange Zeit war es üblich, die Handkraft zur Beurteilung der körperlichen Gesamtkraft heranzuziehen. Bei diesem Test entwickelt der Daumen eine Kraft gegen die Kraft der anderen vier Finger. Doch ist die Handkraft im Sport und im täglichen Leben so wichtig, dass sie als valide anzusehen ist, und lassen sich aus ihr konkrete Rückschlüsse auf die Kraftfähigkeiten aller Muskelgruppen ziehen? Sicher nicht. Moderne Leistungsdiagnostiken stützen sich deshalb in der Regel zur Beurteilung des Kraftniveaus eines Sportlers zumeist auf eine größere Anzahl von Übungen und Muskelgruppen, darunter oft die Bauchmuskeln, Rückenstrecker, Beinstrecker, Armstrecker und die Brustmuskulatur.
Zentral ist die Bestimmung des Einer-Wiederholungs-Maximums (1-RM). Diese Variable kennzeichnet die höchstmögliche Last, die ein Sportler in der jeweiligen Übung einmalig bei korrekter Übungsausführung bewegen kann. Der gemessene Wert stellt dementsprechend die höchste Kraft dar, die das neuromuskuläre System bei einer maximalen willkürlichen Kontraktion entfalten kann. Neben diesem Goldstandard gibt es noch weitere in der Kraftdiagnostik etablierte Verfahren, um Leistungen quantifizierbar zu machen. So kommen biomechanische Sprungkraftmessungen, wie zum Beispiel der Squat Jump oder der Counter-Movement Jump ebenso zum Einsatz wie geschwindigkeitsbasierte Methoden mittels Sensoren, deren Vorteil darin liegt, Sportler zu beurteilen, ohne sie dem Risiko maximaler Belastungen auszusetzen. Auch die Bestimmung der isometrischen Kraft ist in der Trainingspraxis so akzeptiert wie isokinetische Testmethoden oder Tests zum Mehr-Widerholungs-Maximum, die eine hohe Belastung für den Stütz- und Bewegungsapparat und hohe Belastungsspitzen, die zum Beispiel den Blutdruck stark ansteigen lassen, umgehen.
Ist diese Vielfalt an Testungen denn nicht ausreichend, um eindeutige Rückschlüsse auf die aktuelle Leistungsfähigkeit eines Sportlers zu ziehen und Implikationen für zukünftige Trainingsprogramme zu generieren? Schließlich können die Tests, sofern sie durch mehrgelenkige Übungen die großen Muskelgruppen erfassen, ein aussagekräftiges Kraftprofil des gesamten Körpers abbilden. Sie lassen Urteile über die Rate der Kraftentwicklung, die Explosivkraft, die Startkraft etc. zu, sie heben über die Erfassung des Kraft-Geschwindigkeits-Profils individuelle Stärken und Schwächen sportartspezifisch hervor, sie ermöglichen Vergleiche von linker zu rechter Körperseite sowie zwischen Agonisten und Antagonisten und können bei regelmäßiger Anwendung Kraftverläufe über entsprechend lange Zeiträume abbilden.
Keine spezifischen Aussagen möglich
Dem Ursache-Wirkungs-Prinzip kann man durch diese Testbatterien nicht vollumfänglich gerecht werden. Die Testergebnisse lassen auch keinen gesicherten Transfereffekt vom vergangenen Training auf das zukünftige Training zu, gerade im Hinblick auf die Trainingssteuerung. Denn woher weiß der Trainer nach einer Krafttrainingsintervention, welche Übungen ausschlaggebend dafür waren, dass sich die Kraftwerte des Sportlers verbessert haben und die Krafttests dementsprechend über den Zeitverlauf gesehen positiv ausgefallen sind? Höchstwahrscheinlich war nicht der gesamte Übungskatalog für die verbesserten Daten verantwortlich, sondern die einzelnen Übungen haben in unterschiedlichem Maße zu der Entwicklung des körperlichen Zustands beigetragen. Beispiel: Ein Sportler trainiert zehn verschiedene Übungen pro Woche im Kraftraum und steigert dadurch seine Kraft. Welche der Übungen ist nun für die Leistungsentwicklung verantwortlich? Welche Übungen hat der Sportler sinnlos trainiert, ohne dass sie einen Effekt auf seine Kraftfähigkeiten genommen haben?
Die grundlegende Frage, die wir uns stellen müssen, zielt auf die Ursachen ab, die für die Testergebnisse, die sich in den oben erwähnten Verfahren der Leistungsdiagnostik zeigen, verantwortlich sind: Wie wirkt welche Übung? Hat sich die Kraftentwicklungsrate verbessert, weil der Sportler seine maximale Kniebeugeleistung steigern konnte oder weil er zum ersten Mal Niedersprünge in seinen Trainingsplan integriert hat? Der Fortschritt lässt sich über die aufgeführten Testverfahren gut dokumentieren, aber die Stimuli, die den Fortschritt ausgelöst haben, können damit nicht in allen Einzelteilen entschlüsselt werden. An dieser Stelle versagen die etablierten Methoden.
Aus diesem Grund muss unsere Leistungsdiagnostik dringend um eine Echtzeit-Diagnostik erweitert werden. Wir müssen schon während des Trainings wissen, ob die Übung, die wir in einer bestimmten Form trainieren, einen positiven, einen neutralen oder einen negativen Effekt auf unsere körperliche Leistungsfähigkeit ausübt.
Trainingsübungen unmittelbar analysieren
Welche Übungsform mit welcher Lastverteilung von unserer größten bewegungssteuernden Instanz, dem zentralen Nervensystem, aktuell als förderlich bewertet wird, lässt sich anhand von Neuro-Self-Assessments prüfen. Diese Moment-Bewertungen gelingen, weil das Gehirn und das Nervensystem direkt und unmittelbar auf jeden gegebenen Reiz, also auch auf jede Übung, die gemacht wird, reagieren. Die Durchführung sogenannter Assessments ist simpel. Jeweils vor und nach einem motorischen Stimulus führt der Sportler dasselbe Assessment durch und vergleicht die Ausführungsqualität dieser Assessments untereinander. Die Ergebnisse dieser Tests liefern die notwendigen Informationen zur individuellen Eignung von Trainingsübungen und sind zwischen den Übungen in nur wenigen Minuten durchführbar. Die Tests liefern unter anderem Rückschlüsse darauf, wo Ansteuerungsdefizite vorliegen beziehungsweise wie fein die bewegungssteuernden Instanzen die Körperhälften justieren können, und basierend darauf, ob das Gehirn aus einem Sicherheitsbedürfnis heraus beispielsweise in einer der beiden Körperhälften weniger Spannung zulässt. Zeigen sich in diesen Tests zwischen den gleichen Extremitäten beispielsweise große Differenzen, gilt dies häufig als Aufforderung, die schwächere Seite unilateral höher zu belasten. Führen wir Assessments für mehrere Übungen durch, können wir die Trainingsübungen in die Bereiche der leistungsoptimierenden Übungen, der neutralen Übungen und der Übungen unterteilen, die unbedingt aufgearbeitet werden müssen. Vor allem erstere und letztere Kategorie sind dann in der Kraftentwicklung von hoher Bedeutung, da sie einerseits schnelle Leistungssteigerungen versprechen und andererseits die größten Leistungspotenziale darstellen.
Wie funktionieren Neuro-Self-Assessments?
Schauen wir uns dazu die Entstehung von Bewegung auf neuronaler Ebene an. Die Hauptaufgabe des zentralen Nervensystems ist immer zuerst das Garantieren unserer unmittelbaren Sicherheit und unseres Überlebens. Diesem Grundsatz wird außer in akuter Lebensgefahr alles untergeordnet. Dem zentralen Nervensystem ist es egal, ob du einen Purzelbaum schlägst oder eine voll beladene Hantel über den Kopf wuchtest, solange du den Versuch unbeschadet überstehst.
Zur Gewährleistung dieser Sicherheit ist es unabdingbar, dass das zentrale Nervensystem antizipieren und vorhersehen kann, was in naher Zukunft passiert. Dabei agiert unsere höchste steuernde Instanz immer nach demselben Muster: Sie empfängt sensorischen Input aus der Um- und Innenwelt, analysiert und interpretiert diese Informationen und leitet daraus motorische Befehle ab, die über efferente Nervenfasern an die Muskulatur weitergeleitet werden. So kann das Gehirn in Sekundenbruchteilen Bewegungen initiieren, koordinieren und auf Veränderungen reagieren. Je präziser die sensorische Informationslage dabei ist, desto besser gelingt dem zentralen Nervensystem die Prognose der Situation. Eine hohe Informationsqualität aus den Zuliefersystemen – primär dem visuellen, vestibulären und propriozeptiven System – führt zu mehr Sicherheit in der jeweiligen Situation und Bewegung. Wie stark der Sportler ist und wie sehr er sich belasten kann, ist dementsprechend nicht die alleinige Entscheidung seiner bewegungsausführenden Muskeln, sondern primär die Entscheidung des zentralen Nervensystems! Wir sind daher immer nur so leistungsfähig, wie das Gehirn sich in der Situation noch sicher fühlt.
Welche Assessments gibt es?
Zu den wirkungsvollsten Assessments, die darüber entscheiden, ob Sportler ihre Trainingsübungen im Einklang mit ihrem zentralen Nervensystem ausgewählt haben, zählen RAPS. Dazu streckt der Sportler auf Schulterhöhe beide Arme aus und rotiert fortan von der Supination so schnell er kann in die Pronation und wieder zurück. Diese rapiden Pronations- und Supinationsbewegungen werden wahrscheinlich zwischen beiden Seiten und mit der Zeit unterschiedlich kontrolliert und koordiniert ablaufen. Dasselbe Phänomen stellt sich ein, wenn die Trainierenden die Arme nicht auf Schulterhöhe, sondern auf Ellbogenhöhe rotieren. Ein weiteres Assessment-Verfahren, das Aufschluss über Kraft- und Koordinationsdifferenzen geben kann, ist die Rotationsbewegung von der Pronation in die Supination und wieder zurück auf Ebene der Hand. Dazu versucht der Sportler die Handposition zwischen dem Handrücken und der Handinnenfläche möglichst rasch zu wechseln, indem er die eine Hand so schnell es geht ein- und auswärtsdreht. Eine einfache Anweisung des Trainers könnte dabei lauten: „Stelle dir vor, dass ein Nagel durch die Wurzel deines Mittelfingers ragt und du diesen Nagel immer auf der gleichen Stelle der anderen Hand einmal in der Supination und einmal in der Pronation ablegen musst.“ Das letzte in diesem Rahmen vorzustellende Assessment ist die Rumpfbeuge. Dazu beugt der Sportler aus dem neutralen Stand den Oberkörper aus der Hüfte heraus nach vorne und versucht, mit den Fingerspitzen die Zehen zu berühren. Je weiter der Sportler in Richtung Boden kommt oder die Hände eventuell auf diesen abzulegen vermag, desto besser ist dieses Assessment ausgefallen. Über die Ausführung dieser Assessments vor und nach Durchführung der jeweiligen Trainingsübungen gewinnt der Sportler einen Eindruck davon, auf welche Trainingsreize er gut anspricht und auf welche eher nicht. Darüber hinaus gibt es weitere, wesentlich differenziertere Neuro-Self-Assessments, die beispielsweise zusätzlich die reflektorische Stabilität als Maßstab integrieren. Die Vielzahl der Assessments kann aufgrund der Kürze des Artikels jedoch nur plakativ dargestellt werden, sodass die Ausführungen keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben.
Trainingsgestaltung auf Grundlage von Neuro-Self-Assessments
Bereits im Warm-up können die Trainierenden auf dem Fundament der Neuro-Self-Assessments an ihren Schwächen und Stärken gezielt arbeiten. Zum Beispiel können Sportler sowohl sensorisch als auch motorisch die nicht-dominante Körperseite, sprich diejenige, die in den Assessments schlechter abgeschnitten hat, stärker fokussieren als die dominante Seite. Dies geschieht zum einen durch Berührungen und Streichbewegungen an den Extremitäten auf der nicht-dominanten Seite zur Verbesserung der sensorischen Informationsqualität und zum anderen durch höhere Belastungsvolumen in den entsprechenden Trainingsübungen. Im Krafttraining selbst können die Sportler sich – je nachdem wie stark sich ihre Steuerungs-Dysbalancen in den Neuro-Self-Assessments gezeigt haben – auf die nicht-dominante Körperseite konzentrieren und diese sowohl hinsichtlich des Volumens (zum Beispiel im Verhältnis von 3 zu 1) als auch der Intensität (zum Beispiel 70 Prozent des 1 RM im Gegensatz zu 60 Prozent auf der anderen Seite) individuell gestalten. Ebenso kann der Übungskatalog auf Grundlage der Neuro-Self-Assessments variabel gestaltet werden, indem beispielsweise durch unilaterales Bankdrücken mit der Langhantel die Seite der Langhantel, die sich auf der nicht-dominanten Körperseite des Sportlers befindet, mit schwererem Gewicht beladen wird als die gegenüberliegende Seite. Insgesamt sollte in der Trainingsgestaltung, gerade im Leistungssport, auch berücksichtigt werden, dass sich die spezifischen Anforderungsprofile unterscheiden und Symmetrie nicht in jeder Sportart als Goldstandard gewertet werden darf. Asymmetrische Sportarten wie Golfen werden bei regelmäßiger Ausübung immer auch eine sporttypische Krafttopografie nach sich ziehen. In der Trainingsplanung ist es dann wichtig, zwischen Off-Season und Season zu unterscheiden, um etablierte Strukturen nicht innerhalb wichtiger Saisonphasen zu durchbrechen.
Trainingssteuerung individualisieren
Alle Menschen sind verschieden. Ein und dieselbe Trainingsmethode ruft bei verschiedenen Sportlern einen größeren oder geringeren Trainingseffekt hervor. Aus diesem Grund werden vielfach Responder von Non-Respondern und Super-Respondern unterschieden, um deren Anpassungsfähigkeit an bestimmte Trainingsübungen und Protokolle greifbar zu machen und zu erklären, warum unzählige Versuche, Trainingsprogramme von Spitzensportlern zu kopieren, erfolglos verliefen. Die Grundidee, auf der erfolgreiche Trainingsprogramme aufbauen, sollte verstanden und schöpferisch genutzt werden. Erst wenn das Verhältnis von Trainingsbelastung zur damit einhergehenden Ermüdung zu quantifizieren ist und der Sportler weiß, wie seine Trainingsübungen an die Bedürfnisse des zentralen Nervensystems angepasst werden müssen, kann das Training entsprechend strukturiert werden, um eine progressive und individuelle Anpassung zu ermöglichen. Folglich ist nicht die schiere Anzahl der Trainingseinheiten entscheidend, sondern vielmehr die Trainingsplanung, um die Leistungsfähigkeit langfristig zu maximieren. Um eine positive Trainingsbelastung zu erzielen, müssen wir die für uns richtigen Übungen im wirkungsvollen Ausmaß trainieren. Je nach aktuellem Leistungsstand, genetischer Prädisposition, Trainingserfahrung, aktuellem psychischen Zustand und vielen weiteren Faktoren setzt dieselbe Belastung unterschiedliche Trainingsreize. All dies muss durch Neuro-Self-Assessments kontinuierlich abgefragt werden. Die klassische Leistungsdiagnostik reicht hierfür nicht aus.
Fazit: Training individueller ausrichten
Das Training im Spitzensport muss stärker denn je auf die individuellen Aspekte der Sportler zugeschnitten sein, um deren Leistungen in den unterschiedlichen Sportarten zu optimieren. Gerade für Spitzensportler müssen die Krafttrainingsübungen so spezifisch wie möglich sein und im Grundmuster die entsprechende Zielübung imitieren. Die Übungen sollten beispielsweise in der Art des Widerstands, der Zeit und dem Anstieg der Kraftentwicklung und der Bewegungsgeschwindigkeit Ähnlichkeiten aufweisen. Den Anforderungen nach Übungsspezifik sollte in vollem Umfang entsprochen werden. Eine solche Individualisierung spielt eine wichtige Rolle bei der Leistungsdiagnostik, der Trainingsgestaltung und der Regeneration. Wenn eine Trainingsmaßnahme korrekt geplant und realisiert wurde, so ist das Ergebnis des systematischen Übens die Verbesserung der körperlichen Leistungsfähigkeit, unter anderem auch der Kraft, da sich der Körper an physische Belastung anpasst. Um garantieren zu können, dass wir das Maximum aus unseren Krafttrainingseinheiten herausholen, müssen wir deshalb die klassische Leistungsdiagnostik im Rahmen der Kraft mit Neuro-Self-Assessments unterfüttern. Es ist nicht ausreichend, Kraftwerte jeden dritten Monat zu protokollieren und anhand dessen sein weiteres Training auszurichten.
Yassin Jebrini
Neuro-Programming für Krafttraining
In diesem Online-Seminar erfahren Sie, wie Sie ein Krafttraining mithilfe neuroathletischer Strategien steuern können und somit Trainingsprogramme für Ihre Kunden individuell selbst entwickeln.
Die Aufzeichnung zu diesem Online-Seminar gibt es auch auf: www.jebrini-training.deYassin Jebrini
‹ Zurück




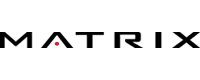








Coming soon!